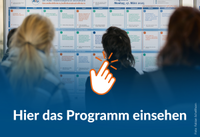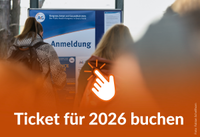Auswahlkriterien für den Kongress Armut und Gesundheit 2026
Formale Auswahlkriterien:
- Die Beiträge enthalten keine Produkt- oder Firmenwerbung.
- Das Abstract ist vollständig.
- Das Abstract ist verständlich und klar strukturiert.
- Kriterium der Vielfalt: Bei der Besetzung des Podiums wird auf eine Vielfalt der Perspektiven geachtet (wie kulturelle Diversität, Perspektive aus Betroffenheit heraus, Gendersensibilität, Praxisperspektiven).
Inhaltliche Auswahlkriterien
Kriterium 1: Bezug zu sozialen Einflussfaktoren der Gesundheit (Armut und Gesundheit)
In den Gesundheitswissenschaften spricht man von den sozialen Determinanten der Gesundheit. Damit sind Einflussfaktoren gemeint, unter denen Menschen geboren werden, aufwachsen, leben, arbeiten und altern. Diese und auch der Zugang zu Macht, Geld und Ressourcen haben einen starken Einfluss auf gesundheitliche Ungleichheiten.
Studien zeigen: Je schlechter die soziale und wirtschaftliche Lage eines Menschen, desto schlechter ist sein Gesundheitszustand. Menschen mit eingeschränktem Zugang zu hochwertigem Wohnraum, Bildung, sozialem Schutz und Beschäftigungsmöglichkeiten haben ein höheres Krankheits- und Sterberisiko. Die Forschung zeigt, dass diese sozialen Determinanten einen größeren Einfluss auf die Gesundheit haben können als genetische Einflüsse oder der Zugang zur Gesundheitsversorgung (WHO).
Zudem beeinflussen sich diese Faktoren oft gegenseitig und können gesundheitliche Ungleichheiten verstärken (Intersektionalität). Auch Rassismus gerät dabei zunehmend in den Blick als gesundheitliche Determinante.
Der Kongress Armut und Gesundheit bringt den engen Zusammenhang zwischen der sozialen Lage von Menschen und ihrer Gesundheit konsequent ins öffentliche Bewusstsein. Der Kongress versteht sich als Plattform für den fachlichen, politischen und zivilgesellschaftlichen Austausch über Wege zur Verringerung von gesundheitlichen Ungleichheiten. Abstracts, die in ihrer Fragestellung, Methodik oder Zielsetzung deutlich auf solche sozialen Einflussfaktoren und ihre Auswirkungen auf Gesundheit eingehen, erfüllen dieses Kriterium.
Kriterium 2: Bezug zum diesjährigen Kongressthema
Der Kongress Armut und Gesundheit 2026 tagt unter dem Motto: „Gesundheit ist politisch! Was ist uns Chancengerechtigkeit (als Gesellschaft) wert?“ Im Mittelpunkt steht die Frage, welchen gesellschaftlichen Wert hat Gesundheit und wie kann eine erfolgreiche, wissenschaftsbasierte Politikberatung im Bereich Public Health gelingen?
Was wir darunter verstehen und welche Diskussionspunkte sich daraus ergeben, haben wir im diesjährigen Diskussionspapier ausgeführt.
Der Kongress tagt jedes Jahr zu einem bestimmten Thema, welches den inhaltlichen Schwerpunkt setzt und intensive Diskussionen dazu ermöglicht. Abstracts, die auf das aktuelle Motto Bezug nehmen, tragen zur thematischen Fokussierung des Kongresses bei. Die Bezugnahme fließt in die Bewertung mit ein, ist jedoch nicht zwingend für die Annahme.
Kriterium 3: Berücksichtigung ressortübergreifender und intersektoraler Perspektiven (‚Health in All Policies‘ und ‚Multilog‘)
Gesundheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie entsteht dort, wo Menschen leben, lernen, arbeiten und wohnen. Das bedeutet: Auch Bereiche wie Bildung, Umwelt, Soziales, Stadtentwicklung, Klima oder Verkehr haben entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit.
Deshalb verfolgt der Kongress den Ansatz „Health in All Policies“ (HiAP), wie ihn auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt. Das bedeutet: Gesundheit soll bei allen politischen Entscheidungen mitgedacht und es sollte ressortübergreifend gehandelt werden.
Doch der Austausch vielfältiger Perspektiven ist nicht nur ressortübergreifend wichtig, sondern auch intersektoral. Das bedeutet, dass verschiedene gesellschaftliche Bereiche Hand in Hand arbeiten, um Lösungen zu finden.
Die Veranstalter*innen des Kongresses sprechen hier auch von einem Multilog: den Austausch unterschiedlichster Akteur*innen – aus Wissenschaft, Praxis, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Selbstvertretungen und Studierendenschaft. Diese Vielfalt an Perspektiven bereichert Diskussionen und Lösungsansätze für gesundheitliche Chancengleichheit.
Bewertet wird, inwiefern der Beitrag unterschiedliche politische oder gesellschaftliche Handlungsbereiche einbezieht und einen interdisziplinären Austausch sichtbar macht, idealerweise bereits innerhalb des Beitrags selbst. Daher legt der Kongress Armut und Gesundheit großen Wert darauf, ob der Beitrag verschiedene Perspektiven miteinander in den Austausch bringen und somit die Idee von „Health in All Policies“ und „Multilog“ erkennbar macht.
Kriterium 4: Relevanz (und Aktualität) des Beitrages
Der Kongress Armut und Gesundheit möchte für die Zusammenhänge zwischen der sozialen Lage und Gesundheit sensibilisieren und diese im öffentlichen Diskurs verankern, um Veränderungen anzustoßen.
Gleichzeitig bietet er Raum für fachlichen Austausch, Wissenserweiterung, Professionalisierung und Vernetzung im Bereich Public Health. Dabei muss die inhaltliche Auseinandersetzung mit Ungleichheit sich stets an sich ändernden gesellschaftlichen Realitäten orientieren, etwa in Bezug auf Pandemien, Kriege, die Klimakrise oder anderen gesellschaftliche Herausforderungen.
Beiträge sollen helfen, neue Perspektiven zu eröffnen, bestehende Wissenslücken zu füllen und Diskussionen voranzubringen. Ein Beitrag gilt als relevant, wenn er mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt:
Aktualität: Der Beitrag greift neue wissenschaftliche Erkenntnisse, aktuelle Erfahrungen aus der Praxis oder gegenwärtige bzw. absehbare Herausforderungen auf.
Wiederkehrende Thematisierungsnotwendigkeit: Der Beitrag behandelt eine Problemlage, die bislang unzureichend im öffentlichen oder politischen Diskurs berücksichtigt wird und daher erneut in den Fokus gerückt werden sollte.
Innovationspotenzial: Der Beitrag bietet eine neue Perspektive auf ein bereits bekanntes Thema, z. B. durch einen innovativen Zugang, eine ungewöhnliche Kooperation oder eine bislang marginalisierte Sichtweise.
Kriterium 5: Partizipation von Menschen, die durch soziale, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Strukturen benachteiligt sind
„Die Akteur*innen des Kongresses eint die Vision, dass alle Menschen ein selbstbestimmtes und gesundes Leben führen können, so wie es entlang der Ottawa Charta aufgezeigt wird. Es braucht eine Public Health-Strategie und -Struktur für Deutschland, die die Situation von Menschen in schwieriger sozialer Lage konsequent miteinschließt (Selbstverständnis Kongress Armut und Gesundheit)“.
Der Kongress Armut und Gesundheit versteht Menschen mit Armutserfahrungen als Experter*innen ihrer Lebenswelten. Den Veranstalter*innen ist es ein Anliegen, ihre Belange und Sichtweise in den Mittelpunkt der Diskussionen zu stellen und - wann immer möglich und sinnvoll - sie selbst hieran zu beteiligen. Ziel ist es, mehr mit den Menschen, statt über sie zu sprechen. Erfahrungen, Bedarfe und Ideen sollen in Forschung, Praxis und Entscheidungsprozesse eingebunden werden.
Welchen Beitrag leistet das eingereichte Abstract, um dieses Ziel zu erreichen?
Kriterium 6: Transfer von Wissenschaft zu praktischer Umsetzung und/oder von praktischer Umsetzung zu Wissenschaft
„Surveillance ist eines der zentralen Public-Health-Aktionsfelder, die die Weltgesundheitsorganisation definiert hat. Die Erfassung von Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten und die Gesundheitsberichterstattung geben daher nicht nur auf Bundes- und Landesebene, sondern auch in den Kommunen wichtige Impulse für die Planung von Gesundheitsförderung und Prävention (Robert Koch Institut)“.
Der Kongress Armut und Gesundheit möchte einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, aus Daten auch Taten folgen zu lassen. Denn nur wenn wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis einfließen und umgekehrt praktische Erfahrungen in die Wissenschaft zurückwirken, kann Gesundheitsförderung nachhaltig gelingen. Dazu braucht es den kontinuierlichen Austausch zwischen wissenschaftlicher Evidenz und praktischer Umsetzung – in Politik, Zivilgesellschaft, kommunalen Strukturen und weiteren Bereichen. Beiträge aus der Wissenschaft sollten dabei Impulse für die Praxis geben und deren Umsetzungsmöglichkeiten reflektieren. Gleichzeitig wird von Praxisbeiträgen erwartet, dass sie sich am aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand orientieren.
Gesundheitsfördernde Praxis sollte evidenzbasierten Kriterien folgen, wie sie z. B. vom Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit formuliert werden.
Bewertet wird, welchen Beitrag leistet das eingereichte Abstract, um dieses Ziel zu erreichen?